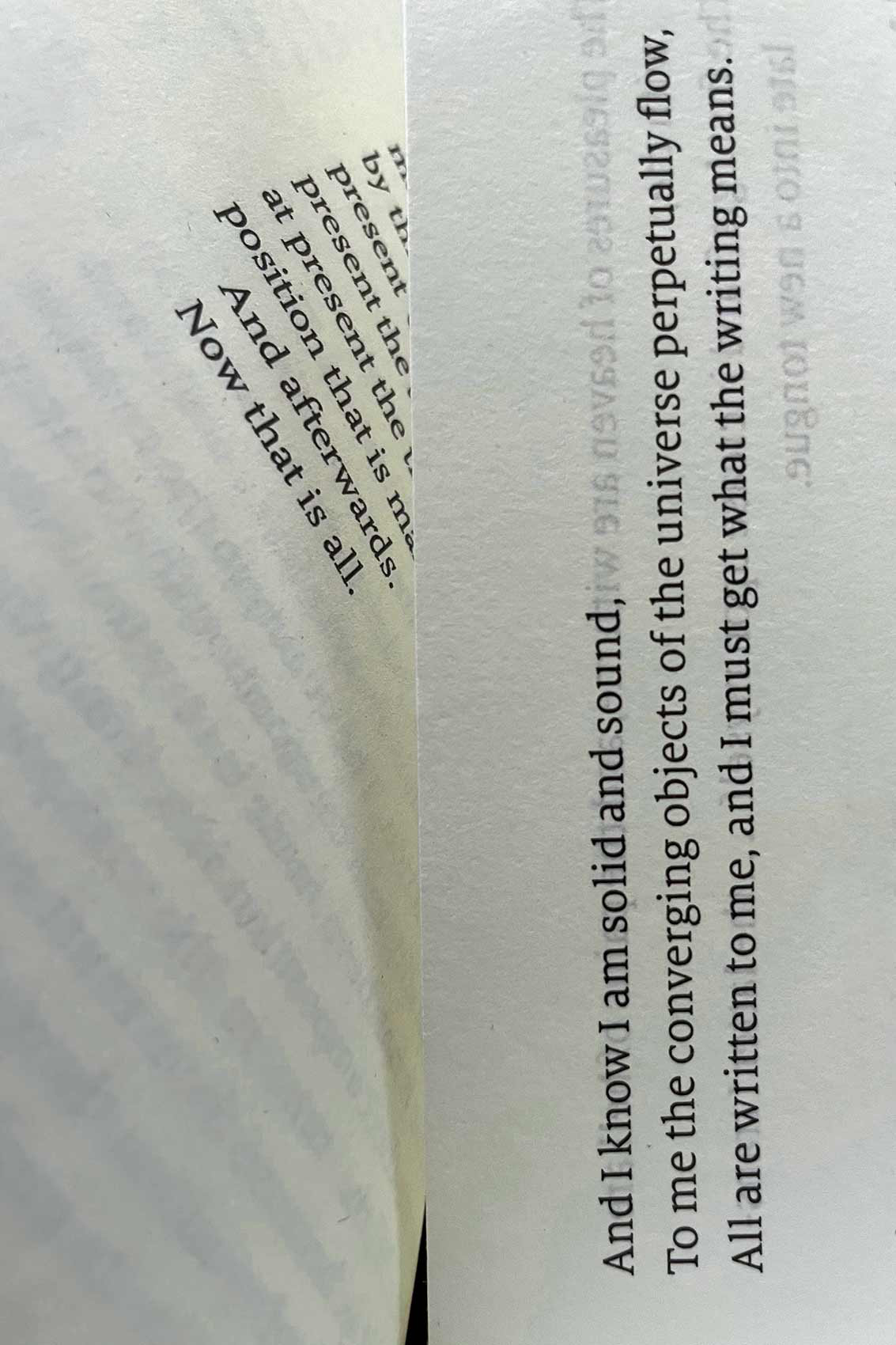
In Indien werden raubkopierte, englische Bücher von den Straßenkindern bei roter Ampel an den Autos und deren Insassen vorbeigetragen (während ich das schreibe, erinnert mich das irgendwie an das Höhlengleichnis – die Bewegung des Vorbeitragens, das Gefesseltsein an das Lenkrad, der Versuch, die Titel und damit den Sinn der einzelnen Bücher zu erkennen, ja, auch das Geblendetsein, wenn man dem Auto entsteigt. Nun egal). Diese Bücher sind natürlich, wie alles, das vorbeigetragen wird, zum Verkauf bestimmt. Von dort stammt meine, eigentlich von Routledge herausgegebene, Ausgabe der Sammlung von Fragmenten und Notizen Walter Benjamins. Er spricht da in einer Anmerkung von „the protective colouring of the planet“. Nun hat er diese Anmerkung natürlich auf deutsch niedergeschrieben, die einführende Geschichte steht hier als Erklärung warum ich diesen Begriff auf Englisch zitiere, und auf Englisch über ihn nachdenke. Eventuell ist er aber nicht nur anekdotisch, sondern ganz ursächlich, mit dieser Sprache verbunden, dadurch, dass dieses Englisch – als lingua franca – für so viele Gestrandete, Entwurzelte auch so etwas wie ein „protective colouring of the planet“ hat; etwas, das sie in die Welt einbettet, indem es ihnen ermöglicht, wieder Auge in Auge mit der Welt zu kommunizieren. Nun spricht Walter Benjamin davon, dass das Grau des herannahenden Unheils, der Faschismus, dieses „protective colouring of the planet“ zerrissen, zerstört hat, dass es dies nun so nicht mehr gibt. Dies heißt natürlich nicht, dass es nicht dennoch davon noch eine Erinnerung gäbe. Allein indem er davon spricht, wird eine Erinnerung erzeugt, und, so wie das bei vielen Erinnerungen ist, müssen wir sie in uns suchen.
Aus einem „protective colouring of the planet“, wenn man es sich nun als eine Art von Einklang innerer und äußerer Gefärbtheit vorstellt, könnte man nun leichten Herzens Expeditionen unternehmen, sich von der eigenen in andere, fremde Farbgegenden bewegen. Und hier kommen wir zu Constanze Schweigers Arbeiten, so wie ich sie bis jetzt kannte. Ich sah sie als eine Art Expeditionen, formale – ja, formale, eventuell mehr als konzeptuelle – in verschiedene Farblogiken. Dies kann man eventuell auch als verschiedene Farblandschaften beschreiben, mit Licht und Schatten, Sümpfen und Höhen, austariert, wie im Landschaftsbild zwischen Farbvaleurs, aber freigestellt von Narration.
Hier erscheint es mir nun ein wenig anders. Sie selbst schreibt: Die Färbungen sind Mai bis September 2020 entstanden, mit selbst gesammelten Pflanzen, die ich beim Spazierengehen fand oder die mir Freunde, Familie geschenkt haben: Brennnesseln aus dem Garten der Akademie oder Löwenzahnblätter aus den Weingärten am Cobenzl oder Walnusskapseln vom Naturdenkmal Am Himmel. Ich hab einiges kennen gelernt, wie Wilde Möhren, oder dass die Rinde von einem Kirschzweig beim Auskochen nach Kirschen riecht.
Dies klingt für mich wie eine Bewegung, die unternommen wird, um sich selbst wieder der Welt zu versichern. Klingt wie jemand, der oder die von einer Reise nach Hause kommt und dort alles abgeht, die Hand über alles gleiten lässt, überall hineinsieht, um zu sehen, ob alles noch da ist.
Sie hat über diese Bewegung ein Tagebuch geführt, eine Form, die wir vor allem als literarische kennen, die aber mit diesem Namen viele forschenden Berufe begleitet und solche Tätigkeiten, bei denen man zu jeder Zeit Rechenschaft darüber geben können soll, was man denn da eigentlich getan hat. Sie nennt es auch ein Färbetagebuch.
In all dem schwingt natürlich diese Zeit der Pandemie mit, mit deren Auswirkungen wir noch leben werden, wenn die Ausstellung eröffnet, und aus der wir unmittelbar kommen. Corona hat in einer Weise für uns ebenfalls eine Art Reise beendet, und dieser Moment des Zu-Hause-Ankommens und die eigene Umgebung erst einmal begreifen zu müssen (und auch hier spielt die Haptik im Wort greifen eine Rolle) hat den Anfang bestimmt, die Notwendigkeit, die wir spürten, uns über die Vorkommnisse der Tage Rechenschaft abzulegen, damit sie nicht einfach so vorbeigingen, beschreibt den weiteren Verlauf.
Auch diese Arbeit nun hat formale Aspekte, die gewählten Farben haben zudem ihre eigene Logik. Constanze Schweiger schreibt: Pflanzenfarbstoffe sind organische Farbstoffe, sie reagieren vor allem auf Licht, aber auch Sauerstoff oder den pH-Wert der Umgebung. Die Färbungen werden sich auf der Vorder- und Rückseite der Objekte unterschiedlich verändern. Das Giluform [der verwendete Gips] färbe ich sehr leicht mit Erdpigmenten ein. Erden sind den Pflanzenfarben irgendwie ähnlich, aber anorganisch, daher lichtstabil. Ohne die Färbung wirkt der eingefärbte Gips diffus weißlich – hellbeige – gräulich, neben der Färbung wirkt er bunt, bekommt eine definiertere Farbe.
Über diese formalen Aspekte hinaus hat diese neue Arbeit aber auch einen narrativen Aspekt oder möglicherweise eher so etwas wie eine Gestimmtheit, eine Melancholie über die Prekarität dessen, der oder die nach diesem „protective colouring of the planet“ sucht – und manchmal aus Lebensnotwendigkeit danach sucht. Walter Benjamin beschreibt diese Gefärbtheit weiter, indem er sagt, es sei das, was uns vergewissert: „that it speaks our language, too“. Ich muss dies weiterhin in dieser Sprache zitieren, wegen der indischen Straßenkinder, wegen all der „commons“, dem, was uns allen eignet, und doch nicht: die gemeinsame Sprache, die Natur, die Welt.
Text von Ariane Müller










